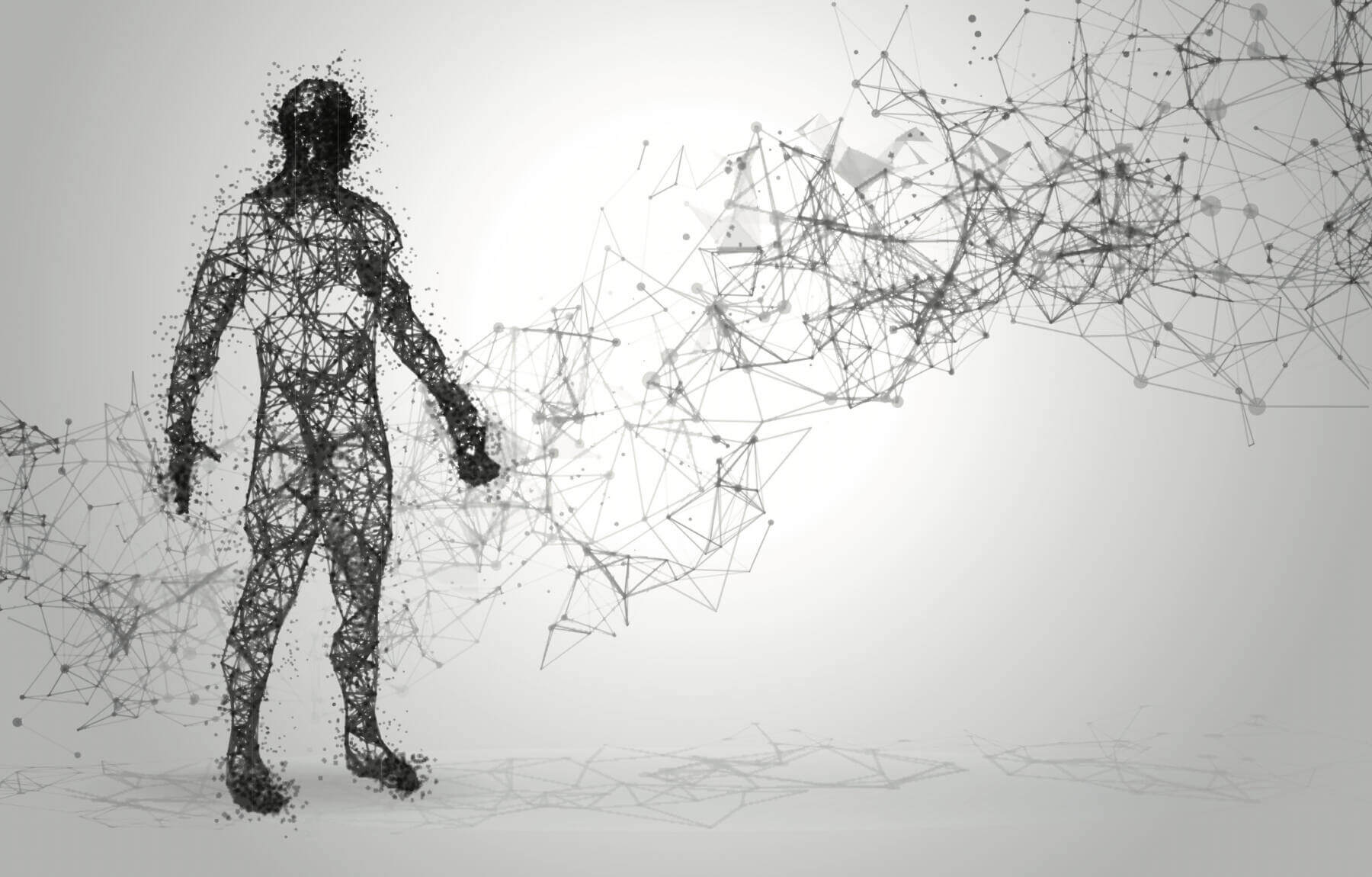Während sich das Gesundheitssystem bislang in erster Linie mit Krankheiten beschäftigt, verschiebt sich dieser Fokus…

Der digitale Patient
Die Digitalisierung hat auch das Gesundheitswesen erfasst – und ist dabei, es gewaltig durchzuschütteln. Das Potenzial ist riesig, der Bedarf zur Veränderung ebenfalls. Die Transparenz und Geschwindigkeit werden für alle Beteiligten innerhalb und ausserhalb einer Organisation immens erhöht. Um im digitalen Rennen mitzuhalten, braucht es einen Kulturwandel: Flache Hierarchien mit breiter Verantwortungsübernahme der Praktiker im Tagesbetrieb, radikale Patientenorientierung, eine Just-do-it- Mentalität und Risikobereitschaft werden eine optimal vernetzte Zusammenarbeit ermöglichen.
Ein Artikel von Stefan Märke und Daniel Walker.
Vor der Digitalisierung zeichneten sich erfolgreiche Unternehmen vor allem dadurch aus, dass sie zuverlässig und effizient «produzieren». Starre Hierarchien und gehorsame Mitarbeitende garantieren den Erfolg. Das Mooresche Gesetz hingegen besagt, dass sich die Anzahl Transistoren und damit die Leistungsfähigkeit eines Prozessors alle 1-2 Jahre verdoppelt. Diese exponentielle Dynamik treibt die digitale Revolution voran. Zunehmend wird entscheidend, wie schnell und umfassend eine Organisation lernen und sich an neue Begebenheiten anpassen kann. In einem solchen Umfeld wird das heute immer noch verbreitete «Künstlertum hinter verschlossenen Türen» schnell zum Auslaufmodell.
Der Transformationsdruck steigt kontinuierlich, denn die Erfahrung aus anderen Industrien zeigt: The Winner Takes It All. So wurden 2019 94.7% aller Suchanfragen in Deutschland über Google getätigt. Bing, Yahoo, T-Online etc. teilen sich den Rest auf. Das ist ein Extrembeispiel, weil die Lösung vollständig digital ist. Aber die zugrundeliegende Logik gilt auch für andere Branchen. Digitale Lösungen kosten viel in der Entwicklung, können jedoch schnell und zu geringen Kosten wachsen. Gleichzeitig wird das Netzwerk mit zunehmender Grösse für alle Beteiligten wertvoller. Als logische Folge davon schliessen sich kleine Firmen zusammen, werden von grösseren übernommen oder vom Branchenprimus teilweise oder vollständig, aus dem Markt gedrängt.
Im Vergleich zu anderen Branchen steht das Gesundheitswesen noch am Anfang seiner Digitalisierungsreise. Doch die nächsten 10 Jahre werden spannend. Viele Technologien stehen aktuell an der Schwelle zur Marktreife. Zahlreiche Patienten und Mitarbeitende messen in ihrem Alltag Gesundheitsdaten. Die künstliche Intelligenz erkennt bestimmte Krebsarten auf Röntgenbildern bereits zuverlässiger als ein Spezialist. Die digitale Patientenakte ersetzt das Faxgerät – hoffentlich schon morgen.
Viele Lösungsansätze müssen aber noch zuverlässiger und genauer werden, um medizinischen Ansprüchen zu genügen. Mit der zunehmenden Integration von bereits heute bestehenden Einzellösungen in ein Gesamtsystem werden nochmals völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Eine Befundung von Röntgenbildern mithilfe künstlicher Intelligenz innerhalb von Sekunden verbessert das Patientenerlebnis allerdings nicht wesentlich, wenn der Patient zuvor drei Stunden auf das Röntgen warten musste. Es gilt das Zitat von Bill Gates, dem Gründer von Microsoft:
Der Einsatz von Technologie in einem effizienten Prozess erhöht die Effizienz. Technologieeinsatz in einem ineffizienten Prozess verstärkt die Ineffizienz.
Damit das Potenzial der Digitalisierung genutzt werden kann, müssen wesentliche Teile der medizinischen Leistungserbringung neu gedacht werden. Wie wir am Beispiel von Herrn Zimmerli sehen werden, beginnt dies lange bevor der Patient im Krankenhausbett liegt.
Herr Zimmerli hat Herzprobleme
Am 30. Juni 2023 wurde Herr Zimmerli 50 Jahre alt. «Ein halbes Jahrhundert», dachte er, «bin ich nun langsam alt?» Er fühlte sich voller Energie. Vor kurzem wurde er befördert, das gab seinem Selbstverständnis neuen Schub. Und jetzt, wo die Kinder langsam selbstständig wurden, hatte er wieder mehr Freiraum, um mit seiner Frau etwas zu unternehmen. Unter diesen Umständen vergass er beinahe, dass bei ihm vor wenigen Monaten eine Tachyarrhythmie (eine Herzrhythmusstörung, wobei das Herz zu schnell und dadurch zu wenig stark schlägt) festgestellt wurde und er deswegen Medikamente einnehmen muss. Ein Glück, dass die Herzrhythmusstörungen überhaupt bemerkt worden waren.
Herr Zimmerli hatte sich nie viele Gedanken um seine Gesundheit gemacht. Um seine Krankenversicherungsprämie zu senken, hatte er jedoch zugestimmt, dass zahlreiche gesundheitsrelevante Daten aus seinem Alltag direkt in seine elektronische Krankenakte gespeist werden: den in seiner Armbanduhr integrierte Messung von Puls, Blutdruck und Sauerstoffsättigung, die Stresserkennung seines Computers am Arbeitsplatz oder sein Gewicht und die Körpertemperatur, die sein Auto bei jeder Fahrt misst. Dank der Blockchain-Technologie sind die Daten vor Missbrauch geschützt. Sollte eine Auffälligkeit vorliegen, würde er frühzeitig darauf hingewiesen. Mit einer frühen Erkennung stünden die Behandlungs- und Heilungschancen deutlich besser.
An einem Sonntag im letzten April geschah es: Herr und Frau Zimmerli hatten den ersten frühlingshaften Sonntag ausgenutzt und kamen gerade von einem ausgedehnten Bike-Ausflug zurück, als seine Smartwatch vibrierte. Auf dem kleinen Bildschirm erschien eine Nachricht, die auf ein potenzielles gesundheitliches Problem hinwies. Herr Zimmerli schluckte leer und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
Während seine Frau duschte, las er auf seinem Tablet: Im Vergleich zu seinen Leistungsdaten in der letzten Saison und im Vergleich zu anderen Männern in seinem Alter mit einem vergleichbaren Lebensstil sei bei der heutigen Biketour aufgefallen, dass seine Leistungsfähigkeit überdurchschnittlich abgenommen habe. Dies könnte ein Hinweis auf Herzprobleme sein. Darum schlug ihm die Gesundheitsplattform vor, sich untersuchen zu lassen. Da es sich um eine datenindizierte Präventivuntersuchung handelte, übernahm die Krankenkasse sämtliche Kosten.
Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich
Vier Jahre später. Herr Zimmerli sitzt im selbstfahrenden Auto auf dem Heimweg vom Büro und schaut die Unterlagen für den Termin vom nächsten Morgen durch, als sich die Gesundheitsplattform erneut meldet. Leider würden die Daten der verschiedenen Überwachungsgeräte auf eine Verschlechterung seines Herzproblems hinweisen. Dies sei kein Notfall, die Situation könne aktuell noch durch eine entsprechend höhere Dosierung der Medikamente ausgeglichen werden. Da die Pillen, die Herr Zimmerli schlucken muss, mit der elektronischen Patientenakte kommunizieren, sei die Dosierung schon während der letzten Tage automatisch erhöht worden.
Gleichzeitig empfiehlt ihm die Gesundheitsplattform, für eine eingehende Untersuchung und Behandlung einen Termin im Krankenhaus zu vereinbaren. Herr Zimmerli wird informiert, dass er mit einem stationären Aufenthalt von 24 Stunden rechnen muss. Er lässt sich per Sprachbefehl die Spitäler, die im Zusammenhang mit Herzrhythmusstörungen die besten Behandlungsergebnisse erzielen, auf die Windschutzscheibe projizieren. Er sortiert die Top-Resultate nach Distanz zu seinem Wohnort und zeigt mit dem Zeigefinger auf «Termin vereinbaren».
Unmittelbar darauf werden ihm mögliche Behandlungsslots angezeigt. Herr Zimmerli entscheidet sich für den Slot am nächsten Montag. Um 9 Uhr soll er im Krankenhaus einchecken. Damit die Behandlung bestmöglich vorbereitet werden kann, gibt er dem für ihn vorgesehenen Behandlungsteam bereit seine somatischen Gesundheitsdaten und seine Krankengeschichte frei. Wenige Momente später hat das AI-System des Krankenhauses seine Daten analysiert und meldet, dass bei der geplanten Behandlung aufgrund des früh erkannten Problems die Erfolgswahrscheinlichkeit bei über 75 Prozent liege.
Patient Zimmerli benötigt eine stationäre Behandlung
Auf dem Weg zum Krankenhaus studiert Herr Zimmerli im Auto seinen provisorischen Behandlungsplan. Er soll zuerst nochmals gründlich untersucht werden. Bestätigt die physische Untersuchung die datenbasierte Diagnose, soll mit intravenös verabreichten Medikamenten versucht werden, den Herzrhythmus in den richtigen Takt zu bringen. Ansonsten müssten die Ärzte mit Stromschlägen (in Kurznarkose verabreicht) versuchen, seinen Herzschlag zu normalisieren.
Manchmal komme es vor, erfährt Herr Zimmerli im Weiteren, dass der Rhythmus innerhalb der ersten Stunden nach der Behandlung wieder ins alte Muster zurückfalle oder sich sogar verschlimmere. Darum muss er bis am nächsten Morgen im Krankenhaus bleiben, so dass ihm im Notfall sofort geholfen werden kann. Zahlreiche Links führen ihn zu detaillierten medizinischen Informationen, Videos und Erfahrungsberichten anderer Patienten. Herr Zimmerli ist etwas mulmig zumute.
Bei der Ankunft im Krankenhaus zeigt sein Smartphone auf dem Bildschirm eine Begrüssungsnachricht an. Mit einem Irisscan verifiziert Herr Zimmerli seine Identität und bestätigt seine Anwesenheit. Das Gerät antwortet im Namen des Krankenhauses: «Wir wünschen Ihnen eine gute Genesung. Bitte folgen Sie der Wegbeschreibung.» Herr Zimmerli schreitet staunend in die angegebene Richtung. Die lichtdurchflutete Eingangshalle erinnert ihn eher an die Hotels von seinen Geschäftsreisen als an ein Krankenhaus. Sein Weg führt ihn über einen Lift in den fünften Stock und dann ins Zimmer 5.24 – ein Spezialzimmer der Intensivstation.
Hier begrüsst ihn eine Pflegefachfrau und streift sie ihm eine Art Smartwatch übers Handgelenk. Damit könne er jederzeit geortet und identifiziert werden. Sie weist Herrn Zimmerli darauf hin, dass sich der geplante Herzultraschalluntersuch um 38 Minuten verzögere. Solche Informationen sehe er auch immer auf dem grossen Bildschirm gegenüber des Bettes; dort sind auch sein Behandlungsplan mit allen aktuellen Terminen, der erwartete Austrittszeitpunkt und die Namen der für ihn zuständigen Fachpersonen aufgeführt.
Er dürfe er sich vor der Behandlung uneingeschränkt auf dem Krankenhausgelände bewegen und die verschiedenen Unterhaltungsangebote entdecken, sagt die Pflegefachkraft. Ein bisschen Bewegung und Abwechslung helfe beim Gesundwerden. Für den Untersuchungstermin soll er sich bitte pünktlich wieder in seinem Zimmer einfinden. Für alle weiteren Fragen kann er sich jederzeit an Alexa wenden. Die charmante digitale Assistentin von Amazon Echo ist in jedem Zimmer installiert und kennt sich mit den Begebenheiten im Krankenhaus bestens aus.
Herr Zimmerli schliesst seine Wertsachen im persönlichen mobilen Safe ein und macht einen Rundgang auf der Station. Er folgt dem Duft von frischem Kaffee und entdeckt einen einladenden Aufenthaltsbereich mit Sofa, kleinen Tischchen und Hockern. Verschiedene Getränke und Snacks stehen zur freien Bedienung bereit. Dynamische Hinweisschilder teilen Herrn Zimmerli mit, dass er auf diese Verlockungen verzichten müsse, da er für die geplante Behandlung nüchtern sein muss. Er greift einen der herumliegenden E-Reader und setzt sich in ein Sofa. Einen kurzen Moment hält er inne und schaut aus dem Fenster. «Das hat nichts mehr mit dem Krankenhaus zu tun, in dem ich damals meine kranke Grossmutter besuchte», erinnert sich Herr Zimmerli.
Das Vibrieren seines Armbands erinnert ihn daran, weshalb er hier ist. Die Ärztin sei unterwegs zu ihm, er solle sich für die Untersuchung zurück in sein Zimmer begeben. Auf dem Weg dorthin beobachtet er, wie ein medizinisches Gerät autonom aus einem Lift herausfährt. Es scheint dasselbe Ziel wie er zu haben. Wenige Minuten nach Herrn Zimmerli trifft auch die Ärztin ein. Es stellt sich heraus, dass das Gerät, welches Herr Zimmerli beobachtet hat, tatsächlich das für den Untersuch benötigte Herzsonografie-Gerät ist. Es fuhr selbstständig von seinem letzten Untersuch zum Zimmer 5.24.
Die Ultraschalluntersuchung ist eine kurze Sache und bestätigt die datenbasierte Verdachtsdiagnose. Gemäss der Ärztin sei dies eigentlich immer der Fall – aktuell seien sie jedoch aus rechtlichen Gründen noch zu dieser ergänzenden Untersuchung verpflichtet. Die Ärztin klärt ihren Patienten noch über die Risiken der um 11.30 Uhr geplanten Behandlung mit möglicher Elektrokardioversion unter Vollnarkose auf. Diesmal bleibt Herr Zimmerli im Bett liegen. Um etwa 11.20 Uhr klopft es an der Türe. Das Anästhesieteam tritt ein und beginnt mit den Vorbereitungen. Zwei verschiedene Medikamente werden ihm langsam und unter strenger Monitorisierung über die Vene verabreicht – leider erfolglos.
Nach einer kurzen Information durch die Ärztin verändert sich das Zimmer von Herrn Zimmerli plötzlich. Wandabdeckungen werden hochgeklappt und verschiedene medizinische Geräte kommen zum Vorschein. Herr Zimmerli wird die Maske übers Gesicht gestreift, und er dämmert langsam weg.
Schnell wieder nach Hause
Alle Spitäler müssen umfassende Messungen der Outcome-Qualität und der Patientenzufriedenheit machen. Ihre Entschädigung hängt grösstenteils von den erzielten Resultaten ab. Die Erfahrungswerte zeigen, dass Patienten weniger Stress empfinden, wenn eine ihnen bereits bekannte Person den Aufwachprozess nach einer Narkose begleitet. Darum hört Herr Zimmerli zuerst die Stimme der ihm schon bekannten Pflegefachfrau, die sanft mit ihm spricht. Sie hat vom zentralen Patientenüberwachungssystem die Meldung bekommen, dass ihr Patient jeden Moment aufwachen wird und hat sich darum an sein Bett gesetzt.
Glücklicherweise war die Behandlung erfolgreich. Wenige Stunden später fühlt sich Herr Zimmerli in der Lage, etwas zu essen, was er gemäss seiner Pflegerin auch unbedingt tun soll. Er wählt über sein Smartphone ein Menü aus, welches rund 10 Minuten später von einem selbstfahrenden Essensroboter auf den kleinen Tisch beim Fenster geliefert wird. «So einfach sollte das Zuhause auch sein!», denkt sich Herr Zimmerli.
Am nächsten Morgen darf Herr Zimmerli ausschlafen. Dies wurde zum Standard in den modernen Krankenhäusern. Durch die kontinuierliche Überwachung über eine Vielzahl von Sensoren und Geräten ist es nicht mehr nötig, die Patienten um 7 Uhr für eine Blutentnahme zu wecken. Um halb zehn Uhr betritt, wie auf seinem Behandlungsplan angekündigt, die Ärztin das Zimmer. Sie lächelt und eröffnet Herrn Zimmerli, dass alle Werte gut aussähen und er nach Hause dürfe. Herr Zimmerli überrascht das nicht, schliesslich hat er regelmässig in seine Krankenakte geschaut und die positiven Werte gesehen. Dennoch ist er froh, dies noch von der Fachfrau bestätigt zu bekommen.
Sie teilt ihm mit, dass er neue Medikamente erhalte. Eine erste Dosis dieser Medikamente hat er bereits erhalten, eine weitere Packung ist bereits per Drohne unterwegs zu ihm nach Hause. Während der ersten Wochen habe er noch ein erhöhtes Risiko, dass sein Herz wieder in den falschen Rhythmus zurückfalle. Darum erhält er ein intelligentes Pflaster aufgeklebt, das mit hoher Ausfallsicherheit seine EKG-Daten aufzeichnet und ans Krankenhaus schickt.
Herr Zimmerli erholt sich die nächsten Tage zuhause und macht kurze Spaziergänge. Hin und wieder gibt ihm seine Gesundheits-App Hinweise, wie er sich verhalten soll. Zur Sicherheit steht rund um die Uhr ein Behandlungsteam bereit, welches im Notfall automatisch alarmiert würde. Am vierten Tag meldet er sich bei seiner Ärztin aus dem Krankenhaus für eine kurze Videosprechstunde. Sie erlaubt ihm, am nächsten Montag wieder zur Arbeit zu gehen und wünscht ihm alles Gute.
Und nun?
Das Beispiel von Herrn Zimmerli zeigt, dass digitale Medizin viel mehr sein wird als «bloss» eine qualitativ hochwertige Behandlung. Dabei geht es nicht darum, Ärzte und Pflege durch Roboter zu ersetzen. Es geht darum, Krankheiten so früh zu erkennen, dass sie gar nicht erst zu einem (grossen) Problem werden und dem Patienten so viel Autonomie und Mitbestimmungsmöglichkeiten wie möglich zuzugestehen. Es geht darum, die richtige Leistung zur genau richtigen Zeit am richtigen Ort anbieten zu können.
Das wird möglich, indem riesige Datenmengen verarbeitet, unterschiedliche Player miteinander verknüpft und kluge Anreize gesetzt werden. Für bestimmt Krankheiten wird auch in 10 bis 15 Jahren eine stationäre Krankenhausinfrastruktur benötigt werden. Doch ganz viele Fälle, die heute die Krankenhausbetten besetzen, werden in ambulanten Einheiten oder sogar zuhause behandelt werden oder im besten Fall gar nicht erst eine Behandlung benötigen. Die Tech-Giganten sind Experten für Nutzererlebnisse, Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz – und sie marschieren dank ihres Wissens mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Medizin. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Spitäler diese Herausforderung meistern werden.
Wie viel Innovation dürfen wir erwarten?
Einiges, was Herr Zimmerli erlebt, mag aus heutiger Sicht abenteuerlich klingen. Tatsächlich neigt der Mensch dazu, die technologische Entwicklung langfristig zu überschätzen. Doch kurz- und mittelfristig tendieren wir dazu, den Einfluss der Technologie zu unterschätzen.
Schauen wir ins Jahr 2009 zurück. Viele heute etablierte Services und Unternehmen existierten noch nicht oder erst seit kurzem. 2009 wurden Uber und WhatsApp gegründet und die allerersten Bitcoins geschürft. Niemand nutzte einen Selfie Stick, Instagram existierte noch nicht, geschweige denn TikTok. In Sachen mobilen Computern waren Netbook der letzte Schrei, das iPad kam erst ein Jahr später auf den Markt. Airbnb und Spotify feierten ihren ersten Geburtstag. Der Energiekonzern Exxon Mobile war das wertvollste Unternehmen der Welt, der heutige Spitzenreiter Apple nicht einmal in den Top 20. Viele Technologien, die Herr Zimmerli erlebt hat, existieren heute schon. Betrachtet man die vergangene Entwicklung, darf man durchaus damit rechnen, dass in 5 bis 10 Jahren viele davon zu unserem Alltag gehören werden – auch im medizinischen Bereich.
Auszug aus Pflegemanagement, Medizin Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, aktualisierte Version 2020.